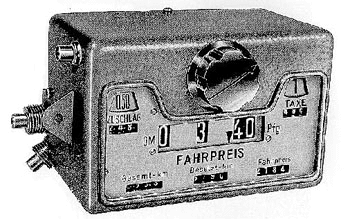Mode d’emploi : Comment se faire de l’argent en publiant des accusations mensongères contre l’ancien état socialiste allemand.
1986 stirbt der Mosambikaner Manuel Diogo bei einer Zugfahrt in Brandenburg. Für die DDR-Behörden ist es ein Unfall. Ein westdeutscher Historiker behauptet 30 Jahre später, es war ein rassistisches Verbrechen. Was ist damals wirklich geschehen?
30.9.2020 - 18:58, Anja Reich und Jenni Roth
Der letzte Tag im Leben von Manuel Diogo ist der 29. Juni 1986, ein Sonntag. In Mexiko-Stadt spielt die westdeutsche Nationalelf im WM-Finale gegen Argentinien. In Sachsen-Anhalt macht sich eine Gruppe mosambikanischer Vertragsarbeiter aus ihrem Dorf Jeber-Bergfrieden auf den Weg nach Dessau, um in einer Kneipe das Spiel zu sehen. Die Argentinier um Diego Maradona gewinnen mit 3:2. Um 22.01 Uhr steigen die Mosambikaner in Dessau in den Zug Richtung Belzig, der sie zurück nach Jeber-Bergfrieden bringen soll, aber einer von ihnen kommt nie an. Manuel Diogo, 23 Jahre alt, Holzfacharbeiter im Sägewerk von Jeber-Bergfrieden, wird um 0.45 Uhr an den Gleisen zwischen Bad Belzig und Wiesenburg gefunden, tot.
Die Transport- und Kriminalpolizei ermittelt, Zeugen werden befragt. Schnell steht fest: Es war ein Unfall. Manuel Diogo war betrunken, schlief im Zug ein, verpasste den Ausstieg, sprang auf freier Strecke aus dem Zug, vermutlich, um zurück zum Bahnhof Jeber-Bergfrieden zu laufen, und wurde dabei vom entgegenkommenden Güterzug erfasst. Seine Freunde merkten erst, dass er fehlte, als sie vom Bahnhof zurück zu ihrer Unterkunft liefen.
Die Akten zum Fall sind umfangreich, Hinweise auf Manipulationen gibt es nicht. Dennoch kommt 30 Jahre später eine ganz andere Version des Falles an die Öffentlichkeit: Manuel Diogo verbringt den Tag nicht in Dessau, sondern zusammen mit einem Freund in Berlin. Der bringt ihn zum Ostbahnhof, setzt ihn in den Zug Richtung Dessau. Neonazis steigen ein, schlagen ihn zusammen, fesseln ihn an Füßen und Beinen, lassen seinen Körper an einem Seil aus dem Zug hängen, sein Schädel wird dabei zertrümmert, die Leiche in Teile zerstückelt an den Gleisen gefunden. Ein brutaler, rassistischer Mord, von den DDR-Behörden und der Staatssicherheit unter den Teppich gekehrt, die Täter bis heute nicht bestraft.
2014 verbreitet Harry Waibel die Version vom Mord in seinem Buch „Der gescheiterte Antifaschismus – Rassismus in der DDR“. Waibel ist ein 74-jähriger Historiker aus Baden-Württemberg, der sich Antifaschist nennt, in Berlin-Schöneberg wohnt und in Archiven nach rassistischen Vorfällen in der DDR sucht. Auf den „Mord an Manuel Diogo“ sei er in der Stasi-Unterlagenbehörde gestoßen, sagt er. Er sagt nie Todesfall, immer nur Mord. Er sagt auch: „Der gesamte Nazismus, Antisemitismus wurde doch vertuscht in der DDR.“
Fast zeitgleich schreibt ein ehemaliger Vertragsarbeiter und Boxer namens Ibraimo Alberto ein Sachbuch über sein Leben. „Ich wollte leben wie die Götter. Was in Deutschland aus meinen afrikanischen Träumen wurde“ erscheint 2014 bei Kiepenheuer & Witsch. Alberto schildert darin, wie er zusammen mit einem Freund in Mosambik für den Auslandseinsatz ausgebildet wird, mit ihm 1981 in Berlin-Schönefeld landet und wie dieser Freund ihn fünf Jahre später in Berlin besucht und in derselben Nacht von Neonazis ermordet wird. Der Freund heißt Manuel Diogo.
Drei Jahre nach der Veröffentlichung seines Buches, 2017, taucht Ibraimo Alberto als Zeuge in einem MDR-Beitrag auf. Darin wird die Mordszene im Zug mit Schauspielern nachgestellt. Am Ende des Beitrages wird der Zuschauer Zeuge, wie das MDR-Team vor einer Hütte in Mosambik steht und der alten Mutter Manuel Diogos die Nachricht vom Neonazi-Mord überbringt. Die Frau bricht in Tränen aus.
Im Jahr 2019 nimmt sich auch der Schriftsteller Max Annas des angeblichen Mordfalles an. „Morduntersuchungskommission“ beschreibt, wie ein ostdeutscher Kommissar den Tod eines Vertragsarbeiters aufklären soll, herausfindet, dass es ein rassistisches Verbrechen war und die Behörden von ihm verlangen, daraus einen Unfall zu machen. Das Buch, vom Rowohlt-Verlag als „der erste große Kriminalroman, der in der DDR spielt“ beworben, von den deutschen Feuilletons als „wahre Geschichte“ hochgelobt, erscheint im Juli 2019 und wird im Dezember 2019 mit dem „Deutschen Krimipreis“ ausgezeichnet. „Ein eminent politisches Buch nach einem historischen Fall“, heißt es in der Jurybegründung.
Es gibt Lesungen, Talkshowauftritte, ein Café in der brandenburgischen Stadt Belzig, nicht weit vom Fundort der Leiche, startet eine Anti-Rassismus-Initiative. In Leipzig erinnert eine Ausstellung an Diogo. Ibraimo Alberto reist 2015 mit einer Delegation von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Afrika und wird vom ehemaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble mit dem Preis „Botschafter für Demokratie und Toleranz“ ausgezeichnet.
Als im Mai 2020 in den USA der Afroamerikaner George Floyd von einem Polizisten ermordet wird und die „Black Lives Matter“-Bewegung auch nach Deutschland schwappt, stellt die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige eine Kleine Anfrage an den Landtag in Brandenburg, Stichwort: „Todesfall Diogo“. Sie fordert, dass die Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen einleitet. Das Medienecho ist riesig. Und tatsächlich: Am 29. Juni 2020 gibt die Staatsanwaltschaft Potsdam bekannt, den Fall neu aufzurollen. Ein Kriminalkommissar wird beauftragt, die Ermittlungen von damals zu prüfen und Zeugen erneut zu vernehmen.
Und so beginnt 34 Jahre später alles noch einmal von vorne. Die Berliner Zeitung recherchiert – fast zeitgleich mit dem Kriminalkommissar – im Fall Diogo, fährt nach Sachsen-Anhalt, telefoniert mit ehemaligen Vertragsarbeitern in Mosambik, spricht mit dem Heim- und Werkleiter aus dem Sägewerk, mit Anwohnern, Historikern, der Linken-Politikerin, kontaktiert die Buch- und MDR-Autoren. Es geht um die Frage, ob es Mord war oder ein Unfall. Im 30. Jahr der deutschen Einheit geht es aber auch darum, wie und von wem DDR-Geschichte umgeschrieben wird.
Manuel Diogo ist 18 Jahre alt, als er auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld landet. Zwei Jahre zuvor, im Februar 1979, haben die Regierungen der DDR und der Volksrepublik Mosambik ein „Abkommen über die zeitweilige Beschäftigung mosambikanischer Werktätiger“ vereinbart. Es ist der 21. Oktober 1981 und kalt. Die Vertragsarbeiter werden auf verschiedene DDR-Betriebe aufgeteilt: Motorradwerk Zschopau, Bahnmeisterei Erfurt, Elektroglas Ilmenau, Getränkekombinat Leipzig. Manuel Diogo gehört zur kleinsten Gruppe: 25 Männer, „Holzindustrie Oranienbaum“, heißt es in den Unterlagen des DDR-Staatssekretariats für Arbeit und Löhne.
Es ist eine weite Reise von Mosambik in die DDR, und nach Jeber-Bergfrieden, wo es außer dem größten Sägewerk der DDR nur noch einen Konsum und eine Gaststätte gibt, scheint die Reise noch weiter zu sein. Kein einziger Ausländer lebt hier, Schwarze kennen die Dorfbewohner nur aus dem Fernsehen. Klaus Nitze holt Diogo und die anderen mit dem Bus aus Schönefeld ab. Er ist ihr Heimleiter und bringt sie in ihre Unterkunft gleich neben dem Werk: pro Zimmer zwei Mann, zwei Betten, zwei Tische, zwei Schränke. Nitze hat zur Vorbereitung extra ein halbes Jahr Portugiesisch gelernt, merkt aber schnell, dass die Sprache das geringste Problem ist: „Da standen auf einmal 25 Leute in Sandalen, ohne Wintermantel, ohne Kutte, die meisten nur mit Sechsklassenabschluss. Wir haben ihnen gesagt, Kleidung haben wir nicht mit, aber der Bus ist warm.“ Im Wohnheim standen Teller mit belegten Käse- und Wurstbrötchen bereit. Niemand rührte das Essen an. „So was kannten die nicht.“
Am nächsten Tag fahren Nitze und seine Frau mit der Gruppe nach Dessau zum Einkaufen: Schuhe, Stiefel, Parkas, lange und kurze Unterwäsche. Nach drei Monaten Deutsch-Intensivkurs beginnt die Arbeit. Harte Arbeit. Holzstämme spalten, schneiden, lagern, Drei-Schicht-System, oft Sonderschichten am Wochenende. Manuel Diogo meldet sich freiwillig für die Sonderschichten, für die es extra Prämien gibt. „Er war der Ruhigste und Fleißigste von allen“, sagt Nitze, „immer bestrebt, Geld zu machen, nur nicht negativ aufzufallen, und der Einzige, der es nach kurzer Zeit zum Gabelstaplerfahrer geschafft hat.“
Seine Kollegen bekommen oft Frauenbesuch, trinken Alkohol, fahren zur Disko in die umliegenden Städte. Auch Manuel hat eine Freundin, Susanne aus Dessau. Eines Tages nimmt er den Werkleiter Günter Geyer mit zu Susanne nach Hause, stellt seinen Chef ihren Eltern vor, wie einen Vater. Zu Geyer hat Manuel, der als Einzelgänger gilt, die engste Beziehung von allen, das stellen auch die Ermittler nach seinem Tod fest. Der Werkleiter selbst nennt Manuel einen Freund. Er habe ihn nach der Arbeit zu Hause besucht, mit ihm Bier getrunken und geredet. Wissbegierig sei er gewesen, einer, der sich nicht in den Vordergrund drängt. Günter Geyer hat Tränen in den Augen, wenn er sich an ihn erinnert.
Spricht man mit Menschen, die ihn kannten, wird aus Manuel Diogo, dem Vertragsarbeiter, dem Neonazi-Opfer, ein junger Afrikaner, der auf der Suche nach dem Glück ist, auch nach sich selbst. Da ist der Mann aus Jeber-Bergfrieden, der damals 14 war, heute in San Francisco lebt und am Telefon von den Besuchen in Manuels Zimmer erzählt und den gemeinsamen Mopedtouren. Da ist die ehemalige Kollegin, die schwärmt, wie nett „der Bengel“ gewesen sei, ein Frauenschwarm, aber nicht nur. „Der Manuel hatte es auch mit Männern.“ Und einmal, sagt sie, habe sie ihn in Frauenkleidern am Bahnhof gesehen. Sein damaliger Zimmernachbar sagt, Manuel habe sich prostituiert, daher das viele Geld. Klaus Nitze sagt: „Ach Quatsch! Die Damen kamen doch alle freiwillig.“ „Unsere Mosis“ nennen die Leute in Jeber-Bergfrieden die Mosambikaner, manchmal auch „Schokos“ oder „Neger“. Das habe man früher eben so gesagt, sagt Nitze.
Manchmal gibt es Ärger mit deutschen Männern, Schlägereien in Discos. Es geht um Frauen, es wird viel getrunken. Auch Manuel, von dem es immer hieß, er rühre keinen Tropfen an, fängt an zu trinken. 1985 beschließt die mosambikanische Regierung, 60 Prozent des Lohnes der Vertragsarbeiter einzubehalten und erst nach ihrer Rückkehr auszuzahlen. Etwa um die gleiche Zeit fliegt Manuel Diogo das erste Mal nach Hause, in einer großen Holzkiste nimmt er „Werte in Höhe von 25.000 Mark“ mit, heißt es in der Akte, darunter eine MZ, ein Motorrad. Nach seiner Rückkehr in die DDR verkauft seine Familie die Sachen, er erfährt es erst hinterher, erzählt sein Zimmernachbar. Manuel Diogos Träume scheinen zu zerplatzen. Er lässt sich nichts anmerken, arbeitet „ohne Tadel“ weiter. In der Akte heißt es: „Seit diesem Zeitpunkt ist zu verzeichnen, dass häufig und in größeren Mengen als bisher Alkohol getrunken wurde.“
Auch am Abend des 29. Juni 1986, des WM-Finales. Manuel Diogo sitzt mit seinen Kollegen in der Dessauer Kneipe vor dem Bildschirm. So erzählen es vier der noch lebenden Mosambikaner aus der Runde. Der Deutsche Roland Hohberg, der 1991 zusammen mit ehemaligen DDR-Vertragsarbeitern den Rückkehrerverein Adecoma in Mosambik gründete, hat sie für die Berliner Zeitung befragt. Sie erzählen, dass sie gute Laune gehabt und getrunken hätten – ziemlich viel sogar: Im Obduktionsbericht heißt es, Manuel Diogo habe fast 1,4 Promille im Blut und 1,8 Promille im Urin gehabt, es wird ein „deutlicher Alkoholgeruch der inneren Organe“ festgestellt.
Der Zug Richtung Belzig ist in ihrer Erinnerung leer, von Neonazis keine Spur. Manuel setzt sich etwas abseits, schläft ein, geht zur Toilette. Die Mosambikaner steigen aus, ohne Manuel – so betrunken hätten sie nicht mehr nach ihm geschaut, sagen sie heute. Die Zugbegleiterin ist laut Akten die Letzte, die Manuel Diogo lebend sieht: Er liegt schlafend auf dem Gang.
Es ist der 30. Juni 1986, gegen ein Uhr nachts, als der Lokführer Markward Michel, damals 42 Jahre alt, angefunkt wird: Im Raum Borne liege ein lebloser Körper im Gleis. Michel soll ihn suchen. Er fährt los, ganz langsam, erst zu weit, dann wieder zurück, bis er ihn im Licht der Scheinwerfer sieht: Manuel Diogo liegt auf dem Bauch, zwischen den Gleisen, das Hemd hochgerutscht. Er trägt eine graue Jeans, Sandalen an den Füßen. Michel steigt aus, für ihn ist sofort klar: ein Unfall. In seinem Haus im brandenburgischen Grubo nimmt er Blatt und Papier und zeichnet auf, wie er sich den Unfallverlauf vorstellt. Diogo ist, als er aus dem Zug sprang, zwischen zwei Wagen geraten, an einem Haken hängengeblieben, ein paar Meter mitgeschleift worden, liegen geblieben und überfahren worden. „Anders geht es gar nicht. Der hat ausgesprochenes Pech gehabt.“
Michel informiert die Transportpolizei, die informiert den Heimleiter. Klaus Nitze schätzt, dass es drei, halb vier Uhr morgens ist, als es an seiner Haustür Sturm klingelt. Er und seine Frau sind wach, sie kommen gerade von einem Geburtstag im nahen Roßlau. Er soll mit in die Pathologie nach Belzig fahren und Manuel identifizieren. Die Fahrt hat sich bis heute bei Nitze eingeprägt, auch das letzte Bild von Manuel. In einer Art Aluminiumschüssel, so lang und breit wie sein Wohnzimmertisch, habe er gelegen, der Körper mit einem weißen Tuch bedeckt, ein Fuß sei zu sehen gewesen, „verkehrtherum“. Und das Gesicht. „Ich habe gleich gesehen, das ist Manuel.“ Die Gerichtsmedizin stellt als Todesursache eine offene Schädelfraktur mit Zertrümmerung der Schädelbasis und weitere schwere innere Verletzungen fest. Ihr Fazit: „Alle festgestellten Verletzungen deuten auf einen Sturz mit anschließendem Anfahren im Liegen, Mitschleifen und teilweise Überfahren eines Reichsbahnfahrzeugs hin.“
Ein paar Stunden später versammeln sich die Kollegen im Büro des Heimleiters im Sägewerk. In seiner Erinnerung zeigen sie keine Trauer, vielleicht sind sie im Schock. Niemand spricht von Mord. Die Polizei befragt Zeugen, Kollegen, Diogos Freundin, die Zugführerin, den Lokführer, den Werkleiter. Die Mosambikaner können sich 34 Jahre später nicht mehr daran erinnern. Aber ihre Protokolle befinden sich in den Ermittlungsakten, Auszüge davon liegen im Archiv der Stasi-Unterlagenbehörde und im Landesarchiv Brandenburg. Es ist keine Rede von Neonazis, es gibt keinen Hinweis darauf, dass hier ein Mord verheimlicht wurde.
Und doch scheint es mehr als 30 Jahre später festzustehen, wird aus der Mordtheorie des Historikers Harry Waibel eine Tatsache. Je öfter sie erzählt wird, desto wahrer wird sie. Und desto wütender wird im anderen Teil der Stadt, in Berlin-Mitte, ein anderer Historiker, der sich mit dem Fall beschäftigt: Ulrich van der Heyden, 66 Jahre alt, geboren in Ueckermünde, Afrika-Experte, Autor des Buches: "Das gescheiterte Experiment. Vertragsarbeiter aus Mosambik in der DDR-Wirtschaft (1979-1990)“.
Vor zehn, zwölf Jahren sei er auf die Akten gestoßen, sagt van der Heyden in seinem Büro in einem Hinterhof der Humboldt-Universität. Dass es ein Unfall war, daran habe er nie gezweifelt. „Da war niemand sonst im Zug außer der Schaffnerin. Die Kumpels sind vorher ausgestiegen. Die waren alle betrunken.“ Das sei öfter passiert, auch, dass sie den Ausstieg verpasst hätten. „Die waren ja von Hause aus keinen Alkohol gewöhnt.“
Bereits vor einem Jahr habe er Verlagshäuser und den MDR auf die Fehler in der Berichterstattung zum Fall Diogo hingewiesen. Er habe sogar Christian Bergmann, einen der MDR-Autoren, in sein Büro eingeladen, ihm die Akten gezeigt und um Richtigstellung gebeten. Als nichts passierte, legte er Beschwerde beim Rundfunkrat und bei der Intendantin des MDR ein. Die Antwort: eine Unterlassungserklärung. Van der Heyden schaltete einen Anwalt ein und protestiert weiter. Er spricht von Fake News, von einem Skandal à la Relotius. Ulrich van der Heyden schreibt schnell, redet schnell und regt sich schnell auf. Wie im Fall Diogo Fakten verdreht werden, aber auch darüber, dass Menschen wie Harry Waibel, die nie in der DDR gelebt haben, das Leben dort bewerten, auch seines.
„Lügen-Harry“ nennt van der Heyden den Historiker aus dem Westen. Waibel kontert:„ Der van der Heyden lügt sich doch einen zurecht.“ Er sitzt in seiner Wohnung in Schöneberg, die gleichen Akten vor sich auf dem Tisch, und erzählt seine Version der Geschichte. „Ein Eisenbahner der Reichsbahn sah die Leichenteile und informierte die Transportpolizei.“ Mit der Untersuchung habe auch die Vertuschung begonnen. „Als Gerichtsmediziner feststellten, dass er 1,4 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde bekannt gegeben, er war betrunken und ist aus dem Zug gestürzt, so war die Legende der Stasi.“
Warum handelt es sich um eine Legende?
„Na, weil die Stasi alles vertuscht hat, was nicht in die Linie gepasst hat!“
Aber hätte die Stasi die Vertuschung dann nicht in die Akten geschrieben?
„Das war doch eine militärische Organisation! Wer sich gegen die herrschende Linie gestellt hätte, hätte mit unangenehmen Folgen rechnen müssen.“
Waibel redet sich in Rage, auch für ihn ist es mehr als ein Kriminalfall. Er sei froh, sagt er, dass der MDR die Sache aufgegriffen habe. Das Buch von Ibraimo Alberto sei ja nicht wahrgenommen worden. Seit dem MDR-Beitrag sei das anders. Mit den Autoren, erzählt er, arbeite er schon lange zusammen, habe ihnen oft Akten für ihre Beiträge zur Verfügung gestellt, auch die von Diogo. Er lasse sich dafür von den Journalisten bezahlen. Von was solle er sonst leben, sagt er. Harry Waibel ist, das begreift man, wenn man an seinem Wohnzimmertisch sitzt, der Spindoctor hinter der Geschichte, der Mann, der Akten verteilt und Informationen streut. Ihm, dem Historiker aus dem Westen, glauben alle, seinetwegen ermittelt die Staatsanwaltschaft 34 Jahre später. Er ist sogar stolz darauf: „Mein Wissen hat mich dazu gebracht, diese steile These aufzustellen“, sagt er.
Es geht, auch das begreift man in diesem Moment, gar nicht um Wissen, um Fakten, sondern um Meinungen, Überzeugungen, Haltungen. Ähnlich wie einst in der DDR. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum sich ausgerechnet die mit dem Fall vertrauten Ostdeutschen in ihrer Empörung so einig sind: Klaus Nitze, der Heimleiter, hat den MDR-Beitrag, der in anderen Versionen und mit anderen Titeln inzwischen auch bei 3Sat, Arte und einer Sendung über DDR-Kriminalfälle lief, auf einer Geschäftsreise in einem Hotelzimmer gesehen. „Alles verdreht“, findet er. Roland Hohberg vom Rückkehrerverein Adecoma in Mosambik ist fassungslos, wie die ehemaligen Vertragsarbeiter, um die er sich kümmert, vom MDR manipuliert wurden. Er habe dem Sender Interviews vermittelt. Daher wisse er, dass die Journalisten ihre Gesprächspartner im Glauben gelassen hätten, der Neonazi-Mord sei bewiesen. „Die haben Suggestivfragen gestellt, die wollten nur eine Story, die gut ins politische Panorama passt.“
Und was sagen die anderen? Die Autoren, die Verlage, der MDR, die Jury des Deutschen Krimipreises? Warum sind ihnen nie Zweifel an der Mordthese gekommen, nie Widersprüche aufgefallen?
Auf die Fragen gibt es nur schriftliche Reaktionen. Und der MDR lässt sich mit seiner Antwort auf den Vorwurf der Suggestivfragen nicht einmal zitieren. Auch mit all den anderen Antworten nicht. Als Beweis für die Mordtheorie verweist die Kommunikationsabteilung des öffentlich-rechtlichen Senders lediglich auf ein Interview mit dem ehemaligen mosambikanischen Botschafter, in dem der sagt, die DDR-Behörden hätten ihm berichtet, dass Skinheads Manuel Diogo umgebracht haben. Die DDR-Behörden, das war in dem Fall das Staatssekretariat für Arbeit und Löhne, bei dem Ralf Straßburg für den Einsatz der mosambikanischen Vertragsarbeiter zuständig war. Straßburg sagt, es sei immer von einem Unfall die Rede gewesen: „Es stimmt einfach nicht, dass wir irgendjemandem erklärt hätten, dass Manuel Diogo aus dem Zug gestoßen wurde.“
Max Annas, der Krimiautor, teilt mit, er habe sich in Schreibklausur für sein neues Buch begeben und momentan keine Zeit für ein Gespräch. Die Jury des Deutschen Krimipreises schreibt, Annas’ Buch sei ein historischer Kriminalroman, der – von einem tatsächlichen Fall angeregt – eine fiktive Geschichte erzählt. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch schreibt, Ibraimo Albertos Lektor sei bereits im Ruhestand und in seiner Datscha in Russland „gerade schwer erreichbar“.
Ibraimo Alberto selbst verweist in einer Mail auf die Interviews, die er bereits gegeben hat. Er habe alles gesagt. Sieht man sich dann aber die Interviews mit ihm im Fernsehen an, liest sein Buch, fragt man sich, was der ehemalige Vertragsarbeiter von dem Streit um den Tod seines Landsmannes überhaupt versteht, was seine Rolle dabei ist.
Albertos Buch ist seine Autobiografie, und es taucht tatsächlich darin immer wieder ein junger Mann namens Manuel auf. Alberto ist mit Manuel Diogo zusammen zur Schule gegangen, war mit ihm im Ausbildungslager, saß mit ihm im Flugzeug und landete zusammen mit ihm am 16. Juni 1981 in Berlin-Schönefeld. Manuel und er trugen einen grauen Arbeitsanzug, heißt es. Und: „Meiner war zwei Nummern zu klein und der von Manuel um einiges zu groß.“ Wie Neonazis ihn später fesselten und folterten, beschreibt er so detailliert, als sei er dabei gewesen. Unter einem Foto steht: „Mein Freund Manuel war eins der ersten Mordopfer Rechtsradikaler in der DDR. Die Täter kamen mit milden Strafen davon.“ Obwohl ja nie Täter ermittelt wurden und es nie einen Prozess gab. Mit dem Namen seines Freundes scheint er etwas durcheinander zu kommen. Manchmal heißt er Manuel, manchmal Manuel Antonio. Und vergleicht man die Ankunftsdaten, stellt sich heraus, dass sie gar nicht zusammen in Schönefeld angekommen sein können: Manuel Diogo ist nicht im Juni 1981 in Berlin gelandet, sondern erst Ende Oktober.
Haben sich die Männer überhaupt gekannt?
Die ehemaligen mosambikanischen Kollegen Diogos sagen, sie hätten nie von Ibraimo Alberto gehört. Manuel wäre auch niemals alleine mit dem Zug nach Berlin gefahren, sie seien immer in der Gruppe unterwegs gewesen.
Konfrontiert man Ibraimo Alberto mit den Widersprüchen, antwortet er mit einem vagen Eingeständnis: Vielleicht erinnere er doch manches falsch, nach so langer Zeit, schreibt er. Womöglich habe Manuel doch in einem anderen Flugzeug gesessen. Und ja, er sei ja auch kein Augenzeuge der Tat gewesen, er erinnere sich nur an ein Gespräch in der mosambikanischen Vertretung, bei dem man ihm erzählt habe, dass ein Mosambikaner im Zug bei Dessau von Skinheads ermordet worden sei. „Warum hätte ich an dieser Aussage zweifeln sollen?“
Seine Geschichte aber ist in der Welt. Und die MDR-Bilder sind es auch. Selbst in der Erinnerung von Zeitzeugen ist die Dokumentation Wirklichkeit geworden. Eine ehemalige Kollegin von Manuel Diogo, die mit einem der ehemaligen Vertragsarbeiter zwei Kinder hat, sagt: „Das war grausam, wurde ja im Fernsehen gezeigt. Die hatten diese Springerstiefel an.“ Fragt man sie, was nicht heute, sondern in den Tagen nach Manuel Diogos Tod erzählt wurde, sagt sie: „Na ja, da dachte man, er war betrunken oder hat die Tür falsch aufgemacht.“
Manuel Diogos Mutter ist 2017 in Mosambik in der Gewissheit gestorben, ihr Sohn sei von Neonazis umgebracht worden. Auch für Harry Waibel steht das fest. Egal, was die Recherchen der Berliner Zeitung ergeben haben, egal, zu welchen Erkenntnissen die Staatsanwaltschaft Potsdam kommen wird. „Erwarten Sie da nichts Großes“, sagt er. „Denken Sie nur an die NSU-Morde.“
Er macht weiter mit seinen Forschungen über die DDR. In alten Akten des Außenministeriums habe er 150 Namen von Ausländern gefunden, die eines „unnatürlichen Todes“ starben, erzählt er. Vor wenigen Tagen hat er diese 150 Namen der Stasi-Unterlagenbehörde geschickt. Da sucht man jetzt nach den Akten.