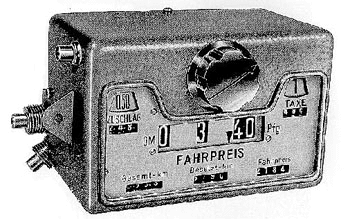Glühbirne: Die kleine Sonne verlischt
▻https://taz.de/Gluehbirne/!5199761
14.7.2007 vonHelmut Höge - Die Glühbirne soll ausgedient haben, weil sie zu viel Energie verbraucht. Wir erzählen ihre Geschichte, in der Syndikate, Terroristen und Siemens-Vorstände vorkommen.
Die Glühbirne soll ausgedient haben - weil sie zu viel Energie verbraucht. Lassen wir sie noch einmal leuchten. Und erzählen ihre Geschichte, in der Syndikate, Terroristen und Siemens-Vorstände vorkommen
In Europa gehen die Lichter aus - mindestens die Glühbirnen, das wünscht sich der Bundesumweltminister. Und prompt wurde im Feuilleton landauf, landab das Ende der Glühbirne - als weltweit gültiges Symbol für Fortschritt, Erfindungsgeist, Ideen und Sozialismus - gefeiert. Der Umweltminister Sigmar Gabriel will es mit seinem „Glühbirnenverbot“ Australien nachtun, wo sein Kollege im dort besonders aussichtslosen Kampf gegen das Ozonloch und den Klimawandel alle Glühbirnen des Kontinents bis 2010 durch so genannte Energiesparlampen ersetzen will.
Die Glühbirne aber ist unsterblich. Obwohl oder weil sie eine Energieeffizienz hat, die umgekehrt proportional zu der des Glühwürmchens ist. Das infolge der Klimaerwärmung sich langsam bis Skandinavien ausbreitende Leuchtinsekt wandelt 93 Prozent der Energie in Licht und nur 7 Prozent in Wärme um, während die Glühbirne eher ein Heizgerät ist. Durch das Glühen ihrer Wolframwendel - „Seele“ genannt - im Inneren des gebärmutterförmigen Glaskolbens - entsteht eine Sonne en miniature. Das macht ihr Licht so angenehm. Im Gegensatz zu dem der Energiesparlampe, die nur eine umgebogene Leuchtstoffröhre ist, zudem giftstoffhaltig, was sie beim Zerbrechen gefährlich und ihre Entsorgung teuer macht. Und sie ist sauhässlich, ebenso ihr Licht. Außerdem hat man ihr, wie der Glühbirne, einen „geplanten Verschleiß“ eingebaut - im Sockel: Sie lässt sich nicht beliebig oft an- und ausschalten und bei Frost springt sie manchmal nicht an. All das ließe sich marktwirtschaftlich „regeln“. Von dort kommt jedoch der größte Einwand gegen den „Energiesparlampenschwindel“: Privathaushalte verbrauchen heute nur noch etwa 8 Prozent der Elektrizität für Licht, der Rest wird für immer mehr Elektrogeräte und Elektronik benötigt.
Als die Glühbirne sich mit dem Edison-Patent - das ein ganzes System vom Wechselstromgenerator über das Leitungsnetz und den Schalter bis zur Wendelgeometrie der Birne umfasst - langsam durchzusetzen begann, gab es in den G[Glühbirnen]-7- Ländern, heute sind es 8 (mit dem exsozialistischen Russland, das eine eigene ruhmreichere Glühbirnengeschichte hat), nur Monopolbetriebe im Westen. In Deutschland war das die von Werner von Siemens und Emil Rathenau gegründete Firma Osram. Die beiden Elektropioniere zerstritten sich an der Frage der Glühbirnen-Vermarktung. Gaslicht war billiger, und noch Anfang der Dreißigerjahre konnte sich ein Arbeiterhaushalt höchstens eine 15-Watt-Birne leisten, die nur wenige Stunden am Tag brennen durfte.
Der jüdisch-protestantische Rathenau wollte das Bedürfnis nach dem neuen Licht auf gut amerikanische Art mit Reklame „wecken“. Zu diesem Zweck illuminierte er z. B. kostenlos ein Theater in München und in Berlin das Café Bauer Unter den Linden, wo er selbst im Keller den Generator mit Wasser kühlte, als der sich überhitzte. Siemens setzte dagegen preußisch-militaristisch auf Beeinflussungsstrategien - gegenüber Staaten und Verwaltungen. Rathenau zog sich bald aus dem Osram-Abenteuer zurück. Die Firma gehört bis heute zu Siemens, im Zuge der Nazieroberungen verleibte der Elektrokonzern sich vorübergehend auch noch Philips und Tungsram ein. In der einstigen „Stadt des Lichts“ werden seit der Wende keine Glühbirnen mehr hergestellt: 1994 wurden im alten Osram-Glühlampenwerk an der Warschauer Brücke, das zu DDR-Zeiten „Narva“ hieß, sämtliche „Arbeitsplätze im Licht“, wie man dort sagte, abgewickelt, und 2004 verlegte man die Glühbirnenproduktion im Spandauer Osramwerk in das Elsass: „Wir sind jetzt ein High-Tech-Betrieb!“, meinte die Telefonistin kichernd. Es werden dort jetzt Hochdrucklampen, u. a. für Straßenlaternen, hergestellt. Der wahre Osram-High-Tech findet im Regensburger Werk statt - in der Leuchtdioden-Entwicklung (die Fertigung befindet sich in Malaysia). Bei den so genannten LEDs meldet Siemens (Deutschland) seit langem mal wieder laufend Patente an. Und sie werden wohl bald auch - zu ganzen „Lichtwänden“ geclustert und in lebensverkürzender Weise hochgetrimmt - die Glühbirnen ersetzen.
Ironischerweise ging der von Rathenau einst gegründete AEG-Konzern nicht an einem Mangel an Patenten pleite, sondern an der schlechten Vermarktung seiner Produkte. Schon Rathenau war mit seiner AEG dem Konkurrenten Siemens entgegengekommen: Erst gründeten sie zusammen mit Edison (General Electric) u. a. ein europäisches und dann ein internationales Elektrokartell: die IEA (International Electrical Association), mit Sitz in Pully bei Lausanne. Kartellexperten gehen davon aus, dass dieses Syndikat, das weltweit die Preise festlegte, Konkurrenten mit Dumpingpreisen und Patentrechtsprozessen niederkämpfte und gemeinsam festlegte, welches Land was produzieren durfte, sich erst 1999 auflöste. Mir selbst schrieb die IEA, sie hätte sich bereits 1989 aufgelöst. Dies wurde jedoch allgemein als zu schön, um wahr zu sein, bezeichnet. Wahr ist jedoch, dass General Electric Anfang der Achtzigerjahre unter Jack Welch aus der IEA austrat - und er den ganzen Konzern umkrempelte. Ende der Neunzigerjahre versuchte der Siemens-Chef von Pierer sich an einem ähnlichen „Konzernumbau“, „10-Punkte-Programm“ von ihm genannt, das dann von seinem Nachfolger Kleinfeld fortgeführt wurde - und wird: 2005 ließ er die Handysparte erst für 350 Millionen Euro bei dem taiwanesischen Konzern BenQ zwischenlagern und dann mit noch einmal 30 Millionen Euro abwickeln. Und nun wird der Communication-Bereich in ein Joint Venture mit Nokia ausgelagert, wobei Siemens wegen des unklaren Ausgangs der ganzen Korruptionsermittlungen und -prozesse gegen den Konzern noch einmal 300 Mio Euro drauflegte. Der Chefredakteur von Europolitan, Marc Sondermann, nannte diese „Verschlankung“: „eine der schwerwiegendsten strategischen Weichenstellungen in der 160 Jahre langen Konzerngeschichte“, dazu noch im Hauruckverfahren durchgezogen, so dass der nunmehrige Aufsichtsratschef von Pierer seinem Nachfolger Kleinfeld über die Presse mitteilen ließ, solche „’Parforceritte’ wie mit der Com-Sparte künftig gefälligst ausbleiben“ zu lassen. Deutlich werde dabei, so Marc Sondermann, „dass Kleinfeld aus der Erkenntnis, seinem Hause lägen konsumentennahe, von Marktinnovationen getriebene Technologiesprünge nicht, die radikalste aller Konsequenzen geschlossen hat: vollständiger und totaler Abschied aus dem Konsumentenmarkt“. (Die Hausgeräte werden bereits im Joint Venture mit Bosch produziert und das PC-Geschäft zusammen mit Fujitsu betrieben).
Dieser ganze Konzernumbau hat zum Ziel, Anschluss an die neuen Kapitalströme zu finden. Vorher war Siemens eine Aktiengesellschaft, deren Aktionäre an „langfristigen Gewinnen durch Dividenden“ interessiert sein mussten, denn von einer „Performance der Siemens-Aktie“ konnte genau genommen keine Rede sein - sie ähnelte einer Staatsanleihe. Und der multinationale Konzern war ja auch noch eng mit „seinem“ Nationalstaat verknüpft. Nach seinem „Umbau“ wurde der Konzern auch für „Investoren“ interessant, die nur auf „kurzfristige Gewinne aus Aktienmärkten“ spekulieren. Die Aktionäre profitieren sogar davon, wenn Siemens sich weltweit mittels Schmiergeldern Aufträge verschafft, die er dann mit erhöhten Preisen wieder reinholt: So kosten z. B. medizintechnische Geräte von Siemens in Russland doppelt so viel wie in Deutschland. Und hier wiederum hält sich der Konzern am Finanzamt schadlos, wie die Spiegel-Journalisten H. R. Martin und H. Schumann in ihrem Buch „Die Globalisierungsfalle“ meinen: „So verlegte z. B. Siemens seinen Konzernsitz steuerrechtlich ins Ausland. Von den 2,1 Milliarden Mark Gewinn des Geschäftsjahres 1994/95 bekam der deutsche Fiskus nicht einmal mehr 100 Millionen, im Jahr 1996 zahlte Siemens gar nichts mehr.“ Auch anderswo nicht: „Das Imperium Siemens führte noch 1991 fast die Hälfte des Gewinns an die 180 Staaten ab, in denen es Filialen unterhält. Binnen vier Jahren schrumpfte diese Quote auf nur noch 20 Prozent.“ Gleichzeitig vermehrten sich bei der Bank aller Banken „Clearstream“ in Luxemburg die „unveröffentlichten Konten“ von Siemens, über die wahrscheinlich ein Großteil seiner Schmiergeldzahlungen abgewickelt wurde: „Die Aufnahme von Siemens sorgte für Wirbel“ in dieser den Banken vorbehaltenen Metabank, erinnert sich der ehemalige „Clearstream“-Manager Ernest Backes. Daneben hat sich Siemens auch in andere Richtung vorgearbeitet - und dabei stets die dicksten deutschen Forschungsgelder, Dritte-Welt-Entwicklungsprojekte und - nach der Wende - die meisten DDR-Betriebe abgegriffen. Daneben versuchte der Konzern erst das DDR-Glühlampenkombinat Narva auf die Abwicklungsliste der Treuhand zu setzen. Als der Betrieb dennoch neu ausgeschrieben wurde, teilten sie allen Interessenten mit, sie bräuchten sich nicht zu bewerben, denn sie würden das Werk selbst übernehmen - dabei hatten sie gar keine Kaufofferte abgegeben. Als dann General Electric den DDR-Vorzeigekonzern Elpro privatisieren wollte, überredete Siemens einen Tag vor Vertragsunterzeichnung die GE-Manager in Belgien, vom Kauf zurückzutreten, dafür wollten sie ihnen helfen, wieder im Iran ins Geschäft zu kommen. Als Samsung den Ökokühlschrankhersteller Foron übernehmen wollte, schrieben die Siemensianer den Koreanern in alter Elektrokartellführermanier, sie würden das als einen unfreundlichen Akt ansehen. Samsung zog daraufhin seine Kaufofferte zurück. Und als die Stromspannung wegen der EU von 220 auf 230 Volt erhöht wurde, verkürzte sich auch noch die Lebensdauer der Glühbirnen von 1.000 auf 800 Stunden. In der Vergangenheit hatte das Elektrokartell immer wieder Lebensdauerverkürzungen beschlossen - von 5.000 auf zuletzt 1.000, während die Glühbirnen im Ostblock bis zu 2.500 Stunden brannten und die in China 5.000. Den lebensdauerverkürzenden Kampf des Elektrokartells aus Gründen der Profitsteigerung schilderte Thomas Pynchon in seinem Roman „Die Enden der Parabel“ - aus der Sicht einer Glühbirne, die dagegen erfolgreich Widerstand leistete. Er dachte dabei konkret an eine Birne in der Feuerwehrwache von Livermore (Kalifornien), die dort bereits seit 1901 brennt (man kann sie sich im Internet anschauen). In Berlin erfand der Elektroniker Dieter Binninger 1983 eine Glühbirne, die 150.000 Stunden brannte - etwa so lange wie die DDR. Er baute sich - ständig von Osram molestiert - eine kleine Birnenproduktion in Kreuzberg auf und wollte dann zusammen mit der Commerzbank Narva übernehmen - stürzte jedoch kurz nach Abgabe ihrer Kaufofferte mit seinem Flugzeug ab. Laut Bild-Zeitung hatte auch die Ermordung des Treuhandchefs Detlef Rohwedder, der Narva wieder von der Abwicklungsliste genommen hatte, etwas mit Glühbirnen zu tun: In dem Moment, als er in seinem Wohnzimmer eine kaputte Birne durch eine neue ersetzt hatte und diese anknipste, wurde er erschossen. Günter Grass arbeitete diese plötzliche „Verdunklung“ später in seinen Treuhandroman „Ein weites Feld“ ein. Beizeiten bereits schrieb der Philosoph Ernst Bloch: „Die Glühbirne im schattenarm gewordenen Zimmer hat die Anfechtungen des Nachtgrauens weit gründlicher geheilt als etwa Voltaire.“ Der Immer-noch-Siemens-Chef Kleinfeld schwor kürzlich beim Bundeskartellamt, Siemens werde den Anfechtungen der Korruption schon bald gewachsen sein: „Die Leute sollen in fünf Jahren sagen können, wie Siemens das gehandhabt hat, ist ein Maßstab, wie man es machen sollte.“ Bulbshit!
#technologie #histoire #DDR #Treuhand #Siemens #capitalisme #Mafia